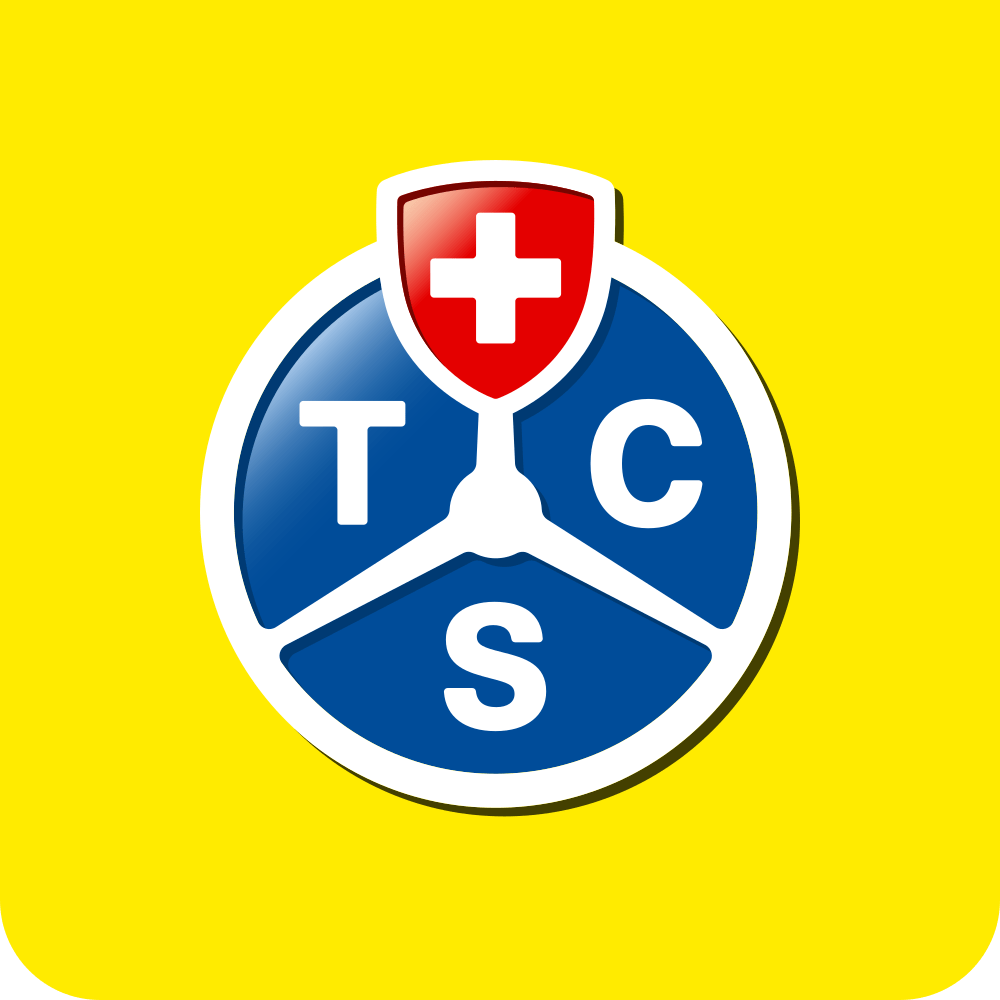Behörden
Darf ein Opfer häuslicher Gewalt nach Trennung in der Schweiz bleiben?

Ein Opfer häuslicher Gewalt behält sein Aufenthaltsrecht nach einer Trennung. Dies gilt auch dann, wenn sich der Täter von dem Opfer getrennt hat.
Mit Entscheid vom 23. März 2021 hat das Bundesgericht bestätigt, dass eine gewaltbetroffene Ausländerin auch dann von der Ausweisung geschützt ist, wenn ihr Partner sich von ihr getrennt hat und nicht umgekehrt. Denn nach Auflösung der Familiengemeinschaft (Fassung zum Zeitpunkt des Bundesgerichtsurteils) darf eine Ehegattin mit ausländischer Staatsbürgerschaft in der Schweiz bleiben, wenn «wichtige persönliche Gründe einen weiteren Aufenthalt in der Schweiz erforderlich machen». Solche «wichtigen persönlichen Gründe» können darin liegen, dass die Ehegattin Opfer ehelicher Gewalt wurde. Der Gesetzgeber will mit dieser Regelung verhindern, dass eine von häuslicher Gewalt betroffene Person aus Angst vor der Ausweisung im gemeinsamen Haushalt wohnen bleibt. Von wem der Trennungswille ausgeht, gilt höchstens als Indiz für die Beurteilung der Zumutbarkeit.
Amt weist Opfer von häuslicher Gewalt aus
Nach der Heirat mit einem Schweizer im Februar 2014 erhält die kosovarische Staatsbürgerin die Aufenthaltsbewilligung. Eineinhalb Jahre nach der Hochzeit trennt sich der Ehemann von seiner Frau. Im Juli 2016 weist das Amt für Migration die Kosovarin aus der Schweiz aus. Ohne Abklärung, ob es zu häuslicher Gewalt gekommen sei, bestätigen die kantonalen Rechtsmittelinstanzen den Ausweisungsentscheid.
Die Frau erhebt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ans Bundesgericht. Dieses weist die Sache an das Kantonsgericht zurück und verpflichtet es, abzuklären, ob eheliche Gewalt stattgefunden habe. Das Kantonsgericht stellt daraufhin fest, dass die Frau Opfer häuslicher Gewalt gewesen sei. Ihr Ex-Mann hatte ihr den Mund zugeklebt, sie geschlagen, mit einer Gabel in den linken Oberschenkel gestochen, einen Metallbecher auf den Kopf geschlagen, ihr Bein blau gequetscht und sie wiederholt gegen ihren Willen zu ihren Schwiegereltern gebracht, «wobei er sie nötigenfalls mit Gewalt an den Haaren ins Auto gezogen habe». Da sich aber nicht die Frau von ihrem Mann getrennt habe, sondern umgekehrt, sei das eheliche Zusammenleben zumutbar gewesen und der Ausweisungsentscheid deswegen zu bestätigen.
Gegen diesen erneuten Ausweisungsentscheid gelangt die Frau mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ans Bundesgericht.
Gewaltbetroffene Migrantinnen unabhängig von Trennungswillen geschützt
Nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung soll die «Gewährung eines Aufenthaltsrechts für Opfer ehelicher Gewalt» verhindern, «dass eine von ehelicher Gewalt betroffene Person nur deshalb in einer für sie objektiv unzumutbaren ehelichen Gemeinschaft verbleibt, weil die Trennung für sie nachteilige ausländerrechtliche Folgen zeitigen würde». Von wem die Trennung ausgeht, kann gemäss Bundesgericht höchstens ein Indiz für die Zumutbarkeit sein. Vorliegend ist der Zusammenhang zwischen der Trennung und er ehelichen Gewalt klar: «Dass in der Folge der gewalttätige Ehemann zuerst den Entschluss gefasst hat, die Ehe zu beenden, vermag nichts am Umstand zu ändern, dass der Beschwerdeführerin angesichts der fortdauernden ehelichen Gewalt ein weiterer Verbleib in der Ehe objektiv unzumutbar gewesen wäre, und sie deshalb (…) Anspruch auf Verlängerung ihrer Aufenthaltsbewilligung hat», so das Bundesgericht.
Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut und weist das Migrationsamt an, die Aufenthaltsbewilligung zu verlängern. Es verpflichtet den Kanton Luzern zudem, der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung in der Höhe von 2 000 CHF zu bezahlen.
Parlament stärkt Schutz von Migrantinnen
Die zum Zeitpunkt des Bundesgerichtsurteils geltende Fassung des ausländerrechtlichen Artikels stellte hohe Hürden zum Nachweis der häuslichen Gewalt auf. Das Parlament hat am 14. Juni 2024 die Regelung der «Auflösung der Familiengemeinschaft» angepasst und gewaltbetroffenen Personen mehr Möglichkeiten gegeben, die Delikte nachzuweisen. So müssen seit dem 1. Januar 2025 die Behörden beispielsweise Bestätigungen von Fachstellen, Arztberichte, Strafanzeigen und -verurteilungen und weitere Nachweise bei der Abklärung des Sachverhalts berücksichtigen.
Aktualisiert am 1. Januar 2025