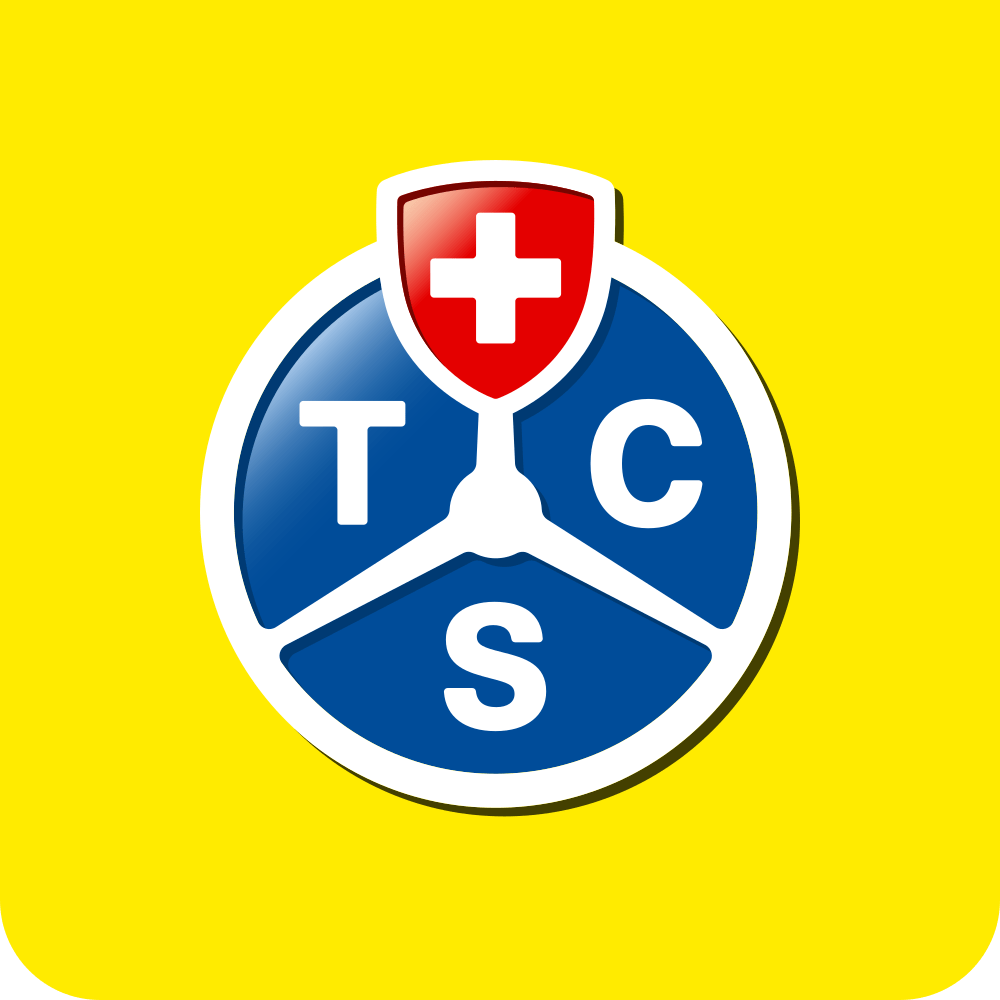Konsum & Internet
Dürfen Medien nur Wahres berichten?

Medien dürfen wahre Tatsachen und Verdachtsmeldungen grundsätzlich veröffentlichen, auch wenn sie persönlichkeitsverletzend sind.
Medien dürfen wahre Informationen grundsätzlich publizieren, sofern diese nicht den Geheim- oder den Privatbereich der betroffenen Person betreffen oder sie unnötig verletzend sind. Als «wahr» gilt dabei, wenn der Bericht die wesentlichen Punkte richtig wiedergibt. Der Bericht darf auch Persönlichkeitsverletzungen beinhalten, sofern das öffentliche Interesse an der Kenntnis der Informationen überwiegt.
Auch eine «Verdachtsberichterstattung» ist zulässig, sofern der Durchschnittsleser erkennt, dass es sich um eine solche und nicht um bewiesene Tatsachen handelt. Dies hat das Bundesgericht mit Urteil vom 14. Januar 2025 bestätigt.
Verein sieht sich in seiner Persönlichkeit verletzt
Eine Tageszeitung berichtet über Aussagen von ehemaligen Kita-Mitarbeitenden zu organisatorischen und personellen Missständen in von einem namentlich genannten gemeinnützigen Verein betriebenen Kitas. Die kritisierte Betriebsleitung kann sich im Artikel ebenfalls zu den Vorwürfen äussern.
Der Verein reicht gegen die Herausgeberin der Zeitung sowie gegen die beiden Journalisten Klage beim zuständigen Bezirksgericht ein. Er beantragt darin unter anderem, es sei festzustellen, dass die Beklagten ihn widerrechtlich in seiner Persönlichkeit verletzt hätten. Das Bezirksgericht weist die Klage ab, auch mit der Berufung vor dem kantonalen Obergericht ist der Verein nicht erfolgreich. Er wendet sich daraufhin mit Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht.
Persönlichkeitsverletzungen können zulässig sein
Die Verbreitung von wahren Tatsachen ist, so das Bundesgericht, «grundsätzlich durch den Informationsauftrag der Medien gedeckt». Auch wenn Aussagen persönlichkeitsverletzend sind, müssen sie nicht widerrechtlich sein: Überwiegt das öffentliche Interesse an Information das private Interesse am Schutz der Persönlichkeit, ist auch eine persönlichkeitsverletzende Berichterstattung zulässig.
Der «Informationsauftrag der Presse» ist, wie das Bundesgericht schreibt, jedoch kein absoluter Rechtfertigungsgrund. Selbst wenn das öffentliche Interesse grundsätzlich überwiegt, sind alle Passagen einzeln daraufhin zu überprüfen, ob in Bezug auf sie ein Informationsbedürfnis besteht. (Siehe auch: «Darf ich im Fernsehen von «Vetterliwirtschaft» sprechen?»)
Die Journalisten berichten in ihrem Artikel darüber, dass gemäss Aussagen ehemaliger Mitarbeiterinnen der Verein in seinen Kitas regelmässig den Betreuungsschlüssel nicht einhalte, die Betriebsleitung die Angestellten auffordere, die Arbeitspläne zu frisieren und dass unqualifiziertes Personal Verantwortung übernehmen müsse. Diese Aussagen sind unstreitig persönlichkeitsverletzend. Allerdings überwiegt hier laut Bundesgericht das allgemeine und erhebliche öffentliche Interesse «an gut geführten Kinderkrippen und einer funktionierenden staatlichen Krippenaufsicht». Auch die Wahl der Journalisten, den Verein namentlich zu bezeichnen, ist zulässig. Denn hätten sie das nicht getan, wären sämtliche Kitas unter Generalverdacht gestanden.
Medien dürfen über einen Verdacht schreiben
Aus medienethischen Gründen dürfen Medien nur Informationen von bekannten Quellen veröffentlichen und müssen unbestätigte Behauptungen als solche bezeichnen. Sie dürfen also nicht den Eindruck erwecken, eine Tatsache sei bewiesen, wenn dies nicht der Fall ist. Gleichzeitig müssen Medien Tatsachen nicht beweisen können, um darüber berichten zu dürfen. Sie dürfen namentlich auch dann über Missstände berichten, wenn diese (noch) nicht von einem Gericht bewiesen sind.
Wie das Bundesgericht ausführt, entsteht bei der Durchschnittsleserschaft durch den Artikel der Gesamteindruck, dass es sich bei den erörterten Missständen um bestrittene, beziehungsweise nicht bewiesene Vorwürfe handelt. Dies umso mehr, als dass der ehemalige Betriebsleiter im Bericht Stellung zu den Anschuldigungen nehmen konnte.
Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab und auferlegt der Beschwerdeführerin die Gerichtskosten in der Höhe von 5 000 CHF.