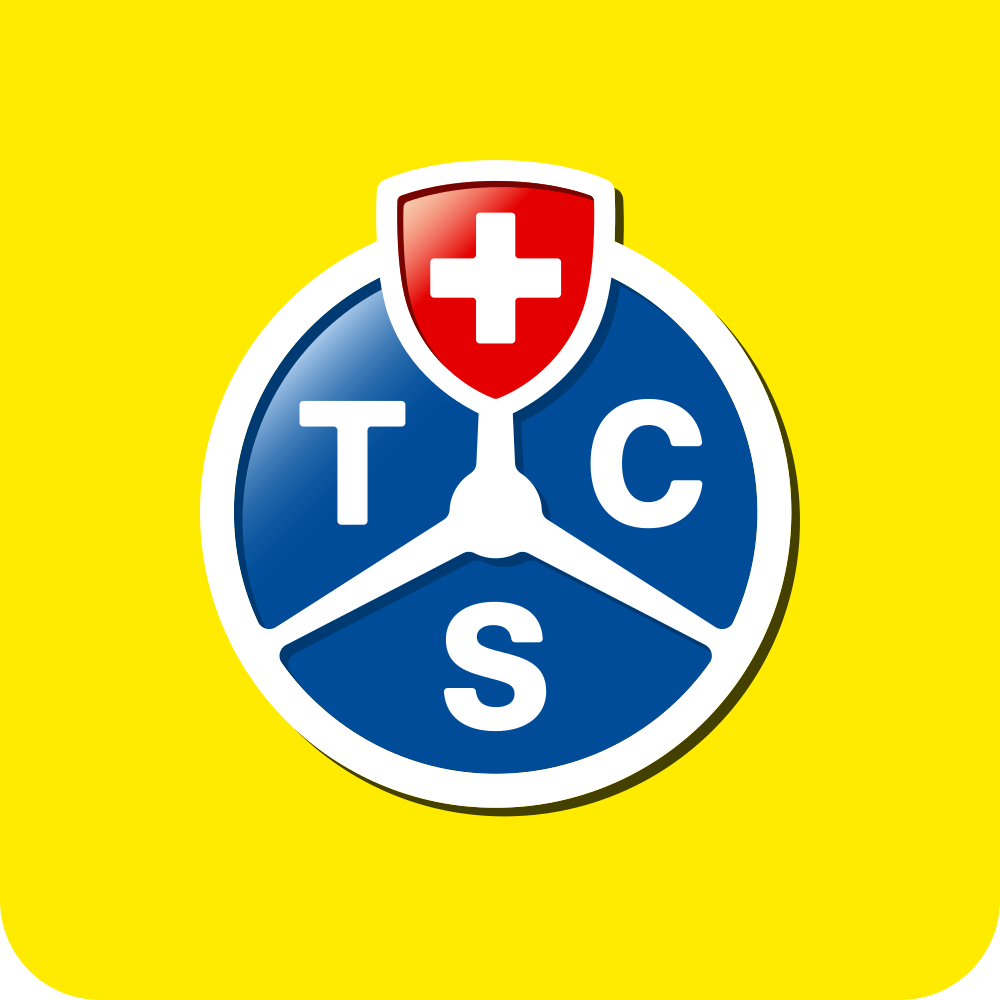Konsum & Internet
Ist es rassistisch, «afrikanische Männer» pauschal zu verurteilen?

Auch in einer politischen Debatte ist es nicht zulässig, Menschen wegen ihrer Ethnie oder ihrer sexuellen Orientierung herabzuwürdigen.
Es ist strafbar, öffentlich «gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung zu Hass oder Diskriminierung» aufzurufen. Die Antidiskriminierungsstrafnorm soll die angeborene Würde und Gleichheit aller Menschen schützen. In einer politischen Auseinandersetzung sind Vereinfachungen und Übertreibungen zwar üblich und zulässig, unsachliche fremden- oder queerfeindliche Äusserungen sind jedoch auch im Rahmen einer politischen Debatte strafbar. Dies hat das Bundesgericht mit Urteil vom 24. April 2024 bestätigt.
Lokalpolitiker veröffentlicht fremden- und queerfeindliche Posts
Ein Lokalpolitiker postet auf seinem Facebook-Profil mehrere Beiträge zu der Abstimmungsvorlage «Ehe für alle». Darin macht er «afrikanischen Flüchtlingen» generell den Vorwurf, kleine Mädchen sexuell zu belästigen. Zudem bezeichnet er Menschen homosexueller Orientierung als «unnatürlich». Das Bezirksgericht spricht ihn der mehrfachen Diskriminierung und des Aufrufes zum Hass schuldig und verurteilt ihn zu einer bedingten Geldstrafe. Das Obergericht bestätigt den Schuldspruch und verhängt zusätzlich eine Verbindungsbusse von CHF 2 500. Gegen dieses Urteil reicht der Lokalpolitiker beim Bundesgericht Beschwerde in Strafsachen ein.
«Afrikanisch» ist ein Sammelbegriff für verschiedene Ethnien
Der Lokalpolitiker argumentiert, in Afrika würden unzählige verschiedene Rassen und Ethnien leben, womit er mit der Verwendung des Begriffs «afrikanische Flüchtlinge» gar keine bestimmte Ethnie habe diskriminieren können. Das Bundesgericht hingegen hält fest, dass der «unbefangene Durchschnittsadressat» die Bezeichnung «afrikanische Flüchtlinge» nicht als Bezeichnung für eine geographische Gruppe versteht, sondern vielmehr als Sammelbegriff für die auf dem afrikanischen Kontinent lebenden Ethnien. Zusätzlich von Bedeutung ist, «dass durch die gewählte Ausdrucksweise beim Durchschnittsadressaten eine Assoziation mit der Hautfarbe hervorgerufen wird». Damit bezeichnen die Ausdrücke «Männer afrikanischer Herkunft» und «afrikanische Flüchtlinge» als Sammelbegriffe Ethnien und Rassen. (Siehe auch: «Gilt die Diskriminierungsstrafnorm auch an der Fasnacht?»)
Wer Homosexuelle als «unnatürlich» bezeichnet, verletzt deren Menschenwürde
In einem Post auf Facebook veröffentlicht der Lokalpolitiker die Aussage, dass die «Ehe für alle» «ein Schritt für weitere Forderungen zu Kindsadoptierungen von unnatürlichen Partnerschaften» sei. Er streitet ab, damit Emotionen oder Hass zu schüren und verweist insbesondere auf eine Bibelstelle, die homosexuelles Verhalten als unnatürlich qualifiziere. Für das Bundesgericht hingegen hat der Lokalpolitiker mit seiner Aussage, die Personengruppe mit homosexueller Orientierung sei unnatürlich, deren Menschenwürde schwerwiegend verletzt.
Überspitzte Äusserungen in politischer Debatte müssen sachlich bleiben
Gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts ist es in «einer Demokratie von zentraler Bedeutung, dass auch Standpunkte vertreten werden können, die einer Mehrheit missfallen oder für viele schockierend wirken». (Siehe auch: («Darf ich auf Facebook Politikerinnen beschimpfen?»)
Die Antidiskriminierungsstrafnorm darf nicht dazu führen, dass die Teilnehmer einer politischen Debatte keine begründete Kritik mehr äussern. Allerdings muss die Kritik insgesamt sachlich bleiben und sich auf objektive Gründe stützen. Die Aussage, dass «afrikanische Flüchtlinge» nach Annahme der Gesetzesvorlage Kinder adoptieren und danach sexuell missbrauchen würden, ist nicht sachlich und stützt sich nicht auf objektive Gründe. Dasselbe gilt für die Aussage, homosexuelle Menschen seien «unnatürlich». Damit hat der Lokalpolitiker kein sachliches Argument geäussert oder konkrete Missstände beanstandet. Die für den Durchschnittleser relevante Kernbotschaft besteht laut Bundesgericht darin, dass Homosexuelle Menschen zweiter Klasse seien.
Das Bundesgericht weist die Beschwerde des Lokalpolitikers ab, bestätigt dessen Verurteilung wegen Diskriminierung und Aufruf zu Hass und auferlegt ihm die Gerichtskosten in der Höhe von CHF 3 000.